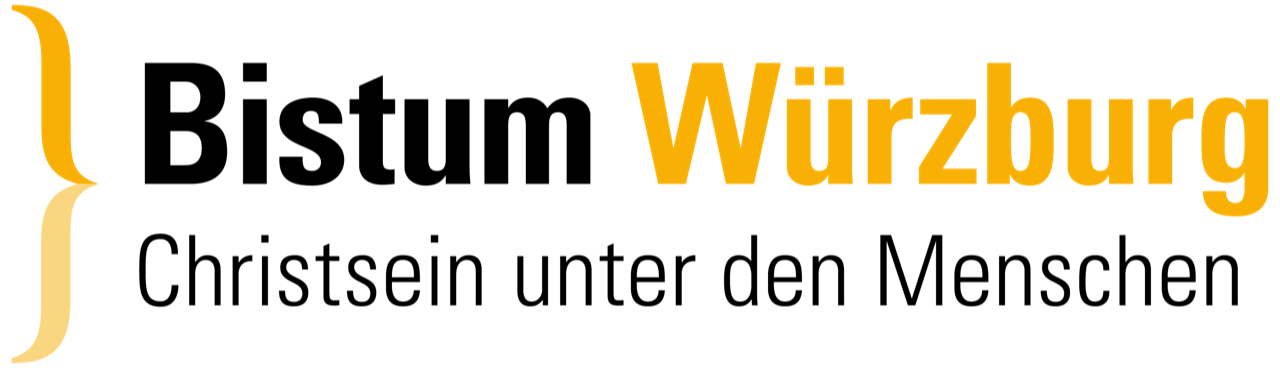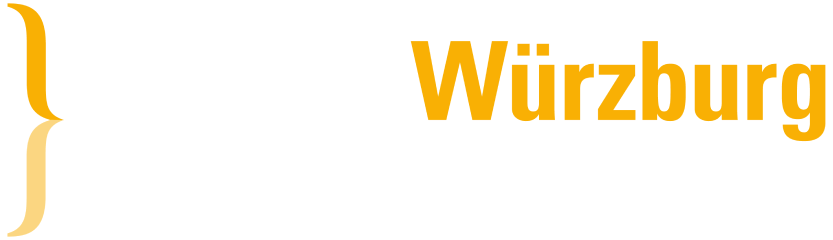Dachau/Würzburg (POW) Wenn Steine schreien könnten: Kieselsteine füllen den Grundriss der ehemaligen Baracke 26. Im Hintergrund ragt eine Pappelallee in den trüben, grauen Februar-Himmel, markiert die frühere Lagerstraße. Die Zeit verschwimmt. 70 Jahre zuvor: Jeweils 17 Baracken stehen links und rechts der Lagerallee, über den Kieselsteinen erhebt sich Baracke 26, der Priesterblock. Dort durchleidet er seine letzten Lebensmonate, dort schreibt er am 9. August 1942: „Wenn nur einmal die Freiheitsnachricht käme.“ Zwölf Tage später stirbt er nach Folter, Hunger und Krankheit im Konzentrationslager Dachau: Pfarrer Georg Häfner (1900-1942), der künftige Selige der Diözese Würzburg.
„In dieser besonderen Atmosphäre am Originalschauplatz ist es leichter, sich in die NS-Zeit zurückzuversetzen, in der Georg Häfner als einer von vielen KZ-Häftlingen litt und starb“, sagt Diözesanfamilienseelsorger Stephan Hartmann beim nachdenklichen Gang durch die heutige KZ-Gedenkstätte Dachau und fügt hinzu: „Es gab doch zahlreiche Menschen, die dem NS-Regime widerstanden haben.“ Neu betroffen angesichts der Unmenschlichkeit an diesem Ort zeigt sich Monsigore Dr. Heinz Geist: „Wie konnte sie Menschen erfassen, von denen man eigentlich eine Spur von Menschlichkeit erwartet?“ Allein die Hoffnung bleibe, dass sich diese schlimmen Ereignisse nie mehr wiederholten – und die riesige Bewunderung, wie lange Georg Häfner und die vielen Häftlinge von Dachau die Unmenschlichkeit durchgestanden haben und wie der Glaube Kraft gab bis in den Tod.
Rund 60 Priester der Diözese Würzburg sind an diesem tristen, nebligen Februartag am Ort des Leidens und Sterbens des Märtyrerpriesters Georg Häfner in Dachau. Weihbischof Ulrich Boom und Pfarrer Stefan Mai, der fünfte Nachfolger von Georg Häfner als Pfarrer von Oberschwarzach, stimmen mit Zitaten aus Häfners Briefen, „die unter die Haut gehen“, sowie mit Gebeten auf den Besuch der Gedenkstätte ein. Realistisch schildert Mai die „zwei Zeiten“ von Georg Häfner: die Zeit als Pfarrer von Oberschwarzach und die andere Zeit als Häftling in der Hölle von Gefängnis und Konzentrationslager. „Georg Häfner würde in der Beliebtheitsskala der Pfarrer von Oberschwarzach weit hinten stehen. Er hinterließ den Eindruck der strengen Autoritätsperson, ohne großes Interesse, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.“ Nicht unbemerkt sei den Oberschwarzachern aber geblieben, dass ihr Pfarrer ein Mann des Gebets war, mit festen Prinzipien und Standhaftigkeit. „Was gibt mir am Leben von Pfarrer Georg Häfner zu denken?“, fragt Mai in die Stille. Nicht das, was ihn beliebt gemacht hätte, sondern das Sperrige, Kantige habe ihn im Konzentrationslager die Widerstandskraft bis zum Tod gegeben. „Vielleicht sind es gerade die sperrigen Seiten an mir, die in den entscheidenden Momenten des Lebens mir Rückhalt und Kraft zum Durchhalten geben“, übersetzt er Häfners Haltung ins heute.
Kraft zum Durchhalten benötigte Georg Häfner vom ersten Moment im Konzentrationslager an. Beim Gang durch das Jourhaus, dem Häftlingszugang mit dem zynischen Spruch am Gittertor „Arbeit macht frei“, klingen die Aussagen des Mithäftlings Pfarrer August Eisenmann über Georg Häfners Ankunft in Dachau nach: „Sein Empfang im Lager war, wie er mir erzählte, fürchterlich gewesen: er wurde mehrfach mit Fäusten traktiert, bekam Kinnhaken, so dass er blutete und zu Boden stürzte. Am nächsten Tage gings noch einmal in der gleichen Weise so.“ Politische Gegner des NS-Regimes, „Berufsverbrecher“, Sektenmitglieder, Homosexuelle, Sinti und Roma, Juden, „Asoziale“ und über 2700 Priester aus über 20 Ländern – vor allem aus Polen – durchschritten wie Pfarrer Häfner das Tor zum KZ, wurden in Nummern verwandelt, zu Verbrechern abgestempelt – insgesamt über 200.000 Menschen. Mehr als 43.500 von ihnen starben in Dachau und in den Außenlagern. „Ehrlos, wehrlos, rechtlos“ beschreibt Weihbischof Boom mit wenigen Worten die Situation der Häftlinge.
„Es ist sehr bedrückend, wenn man die Zellen sieht. Priestersein war damals eine große Herausforderung und eine radikalere Entscheidung“, sagt Pfarrer Matthias Leineweber nach dem Besuch des Bunkers. Dort wurden Lagerstrafen und Erschießungen durchgeführt, dort waren geistliche Sonderhäftlinge wie Martin Niemöller und Domkapitular Johannes Neuhäusler inhaftiert. Die Frage bewegt den Würzburger Priester: „Wie konnten Menschen diese Bedingungen im Konzentrationslager, diese Hoffnungslosigkeit aushalten?“ Häfners Durchhalten in Dachau beeindruckt ihn: „Hier durchzuhalten, hier den Glauben zu bewahren: das ist für mich die große Leistung Georg Häfners.“ Für Pfarrer Nikolaus Hegler aus Glattbach liegt die Bedeutung Häfners darin, dass er als gläubiger Christ sein Glaubenszeugnis gelebt hat. „Georg Häfner erkannte, welch dämonische Kräfte im NS-Regime wirkten und setzte sich konsequent dagegen zur Wehr.“ Und Würzburgs Dompfarrer Dr. Jürgen Vorndran, aus dessen Pfarrei Georg Häfner stammte, sieht in der größter Not, in der sich Häfner befand, Gottes Gnade übergroß: „Anders kann ich mir nicht erklären, wie Georg Häfner den Mut fasste, dieses Leben im Konzentrationslager im Glauben zu bewältigen.“
Unweit der Baracke 26 stehen die vier Verbrennungsöfen im Krematorium des Konzentrationslagers. Stille. Hier wurde Georg Häfners Leichnam eingeäschert – wie so viele tote Häftlinge. „Was trägt dich im Konzentrationslager?“, fragt Weihbischof Boom vor der Stätte des Todes. „Georg Häfner spricht auch hier vom liebenden Gott, der dich nicht verlässt und bis ins Dunkelste mitgeht. Das ist das Zeugnis, das uns durch Georg Häfner geschenkt wird.“ Für die Würzburger Priester bleibt das Gebet. Nachdenklich gehen sie durch den Wachturm in das direkt ans KZ angebauten Karmelkloster Heilig Blut. In der Vesper singen sie, dass der Glaube keine Nacht kenne und sein Licht den Menschen im Dunkel aufstrahle. Mit Schwester Veronika Elisabeth Schmitt betrachten sie die karmelitische Spiritualität, der Georg Häfner als Mitglied des Dritten Ordens vom Berge Karmel eng verbunden war. „Gott ist kein Ferner, sondern in jedem Menschen jederzeit präsent und gegenwärtig. Gott ist die Mitte der Seele“, meditiert die Karmelitin. Diese Spiritualität habe Georg Häfner Kraft für sein Leiden im Konzentrationslager gegeben.
Beim Gottesdienst in der Karmelkirche führt Weihbischof Boom den Gedanken fort. Georg Häfner und vielen Mitgefangenen habe Kraft gegeben, dass sie den Blick auf Gott richteten. Die NS-Machthaber hätten den Menschen ihre Namen und ihre Geschichte genommen und sie zu Nummern gemacht. „Wenn die Kirche Georg Häfner seligspricht, dann steht er für viele Menschen, die von Menschen zu Nummern gemacht werden, denen ihre Individualität genommen wird.“ Die Seligsprechung sei eine Zusage an das Leben, dass ihm kein Machthaber etwas anhaben könne: „Jeder Mensch hat einen Namen, der ihm nicht genommen werden kann.“
Zur Bildergalerie