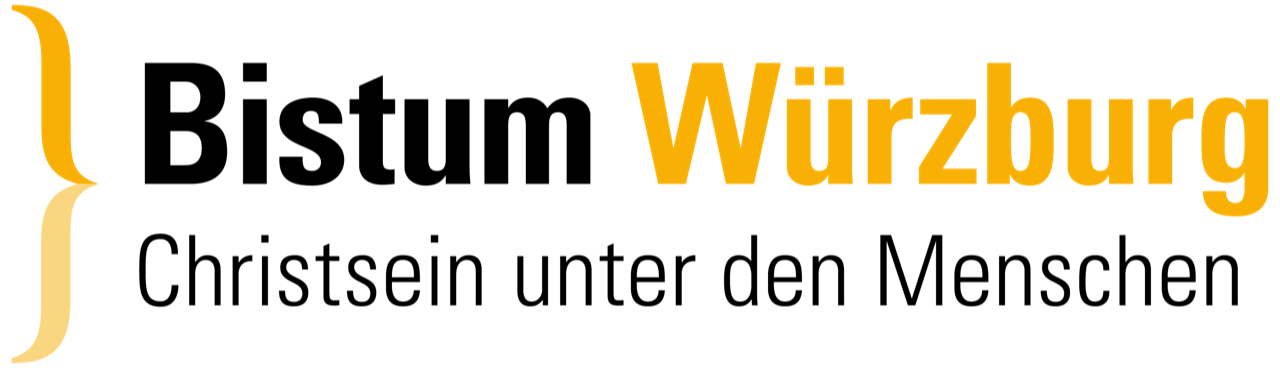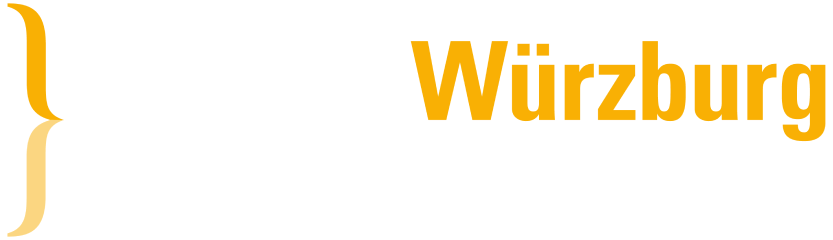Evangelium
In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn.
Während er noch am See war, kam einer der Synagogenvorsteher namens Jaïrus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an; er sagte: Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie geheilt wird und am Leben bleibt! Da ging Jesus mit ihm.
Unterwegs kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten, und sagten zu Jaïrus: Deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht! Glaube nur!
Und er ließ keinen mitkommen außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Tumult sah und wie sie heftig weinten und klagten, trat er ein und sagte zu ihnen: Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus.
Er aber warf alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die, die mit ihm waren, und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm: Talita kum!, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh’ auf! Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt.
Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen. Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren; dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben.
Markusevangelium 5,21–24.35b–43
Wofür braucht es den Tod aus naturwissenschaftlicher Sicht?
Was wir Tod nennen, ist Teil eines umfassenden Transformationsprozesses. Diese Welt hängt am Tropf der Sonne. Wir kennen, grob gesprochen, die Produzenten, also die photosynthetisch aktiven Pflanzen, die die Sonnenenergie abgreifen. Wir kennen die Konsumenten, also die Pflanzen- und die Fleischfresser, und die Reduzenten, also Bakterien, Pilze und andere, die alles wieder in den stofflichen Ursprungszustand zerlegen. Der Tod ist jeweils der Schritt zwischen den Etappen dieser Kreislaufwirtschaft.
Wäre die Evolution bis hin zum heutigen Menschen denkbar ohne den Tod?
Ganz sicher nicht. Wenn man alle Lebewesen, die es je gegeben hat, erhalten hätte, hätte diese Welt ein Vielfaches an Biomasse nötig gehabt und keinen Fortschritt erzielt. All die Moleküle, aus denen wir auch nur aktuell zusammengesetzt sind, waren schon zuvor rein rechnerisch in vielen anderen Lebewesen vorhanden.
Ist der Tod naturwissenschaftlich betrachtet gut oder schlecht?
Gut oder schlecht, also eine moralische Kategorie, ist eigentlich keine naturwissenschaftliche oder spezieller biologische Kategorie. Man würde eher von funktional und dysfunktional reden. Man könnte vielleicht sagen, der Tod ist in Bezug auf ein Individuum dysfunktional. Aber in Bezug auf die Stammesgeschichte und die ganze Evolutionsgeschichte ist er sehr wohl funktional. Er ermöglicht Innovation und Fortschritt.
Sie sind auch Theologe: Warum behauptet das Buch der Weisheit, Gott hätte den Tod nicht gemacht?
Ich denke mir das so: Wenn Gott als Schöpfer aus dem Nichts gedacht wird, dann hat er doch zuerst etwas ins Sein gestellt, etwas existieren lassen, was zuvor nicht war. Er hat es – modern gesprochen – sich evolutiv vom toten zum belebten Sein entwickeln lassen. Dass überhaupt etwas ist und nicht nichts und dass das, was ist, sich vom toten zum belebten Sein entwickeln konnte und kann, das könnte doch Gottes prinzipielles Interesse am Sein dokumentieren. Dass er also mehr Interesse am Leben hat als am Tod.
Und warum wird die Verantwortung für den Tod auf den „Neid des Teufels“ geschoben?
Der berühmte Jesuit Pierre Teilhard de Chardin hat einmal gesagt: „Gott macht eine Welt, die sich macht.“ Das heißt: Diese Welt ist eine Werdewelt. Und diese Welt kann sich nicht nur machen, sondern auch kaputtmachen. Das ist mit den Namen Napoleon, Stalin, Mao, Hitler, Pol Pot, Putin und vielen mehr auf traurigste Weise zu belegen. Hier im moralisch zurechnungsfähigen, selbstverantwortlichen Menschen kann sich – bildhaft gesprochen – der „Neid des Teufels“ auswirken.
Haben Gott und das Prinzip des Todes aus Ihrer Sicht etwas miteinander zu tun?
Ich glaube: Ja. Das Sterben hat auch etwas von einer Geburt. Wir Diesseitsembryonen wachsen und müssen aus dem Uterus dieser Welt hinaus. Was dem Embryo wie höchste Bedrohung erscheinen muss, das ist in Wahrheit der Übergang in eine neue Dimension einer nur ahnungsvoll erfahrbaren Freiheit und Realität.
Sie arbeiten jetzt als Krankenhausseelsorger und haben oft mit Menschen zu tun, die schwere Diagnosen bekommen: Warum kommen die Menschen so schlecht mit dem Tod zurecht?
Nicht alle kommen schlecht mit dem Tod zurecht. Manche alten Menschen ersehnen ihn sogar; sie sind, wie es die Bibel nennt, lebenssatt. Sie ersehnen das Ende der Endlichkeit und das ist – manchmal ausgesprochen, manchmal unausgesprochen – die Unendlichkeit. Manche flüchten auch in den Tod als Ende der Lebensangst, oder sie nehmen ihn als Besiegelung des schon vorher erfahrenen sozialen Todes. Viele sterben erwartungs- oder gar hoffnungsvoll.
Erleben Sie Menschen, die Gott für ihren Tod verantwortlich machen?
Immer wieder einmal. Sie fragen: Womit habe ich das verdient? Ich habe doch immer einigermaßen gut gelebt! Nicht selten kommen solche Menschen aber auch aus dem anfänglichen Hadern mit Gott oder Zweifeln an Gott im Verlauf ihrer Krankheit doch noch zu einer Aussöhnung mit Gott und den oft schweren Umständen ihres Lebens. Sie sterben mit sich, mit der Welt und mit Gott versöhnt.
Erleben Sie auch Menschen, die den Tod als natürlichen Teil des Lebens akzeptieren?
Ja, die gibt es. Aber die meisten, die versöhnt gehen, haben eine irgendwie religiöse Deutung. Ich spende in der Woche mehr als zehn Krankensalbungen; daran wird deutlich, wie sehr selbst in kirchenfern gewordenen, aber oft religiös gebliebenen Menschen eine Sehnsucht nach Heil in Gott gegeben ist.
Im Evangelium geht es um den Tod eines Kindes. Sieht da die Sache nochmal völlig anders aus?
Der Tod eines Kindes wird von den Angehörigen und auch vom Pflegepersonal oft als besonders tragisch erfahren, verglichen mit dem Tod eines alten Menschen. Die besondere Hilfsbedürftigkeit des Kindes, die Kürze seiner Lebenszeit – all das intensiviert bei uns Mitgefühl und Trauer.
Der Tod ist ein biologisches Faktum. Ist er noch mehr?
Er ist viel mehr. Dem biologischen Tod kann der Tod in sozialer, in existenzieller, in wirtschaftlicher, in sinnorientierter Hinsicht mitverursachend vorausgehen.
Kann er durch Gottes Lebenskraft überwunden werden?
Das ist zumindest meine und die Hoffnung einer ökumenisch vereinten Christenheit. Der Gott, der Materie ins Sein und das Seiende evolutiv ins Leben führt, der führt uns auch über dieses, unser Leben hinaus in die Fülle seines Lebens hinein.
Interview: Susanne Haverkamp